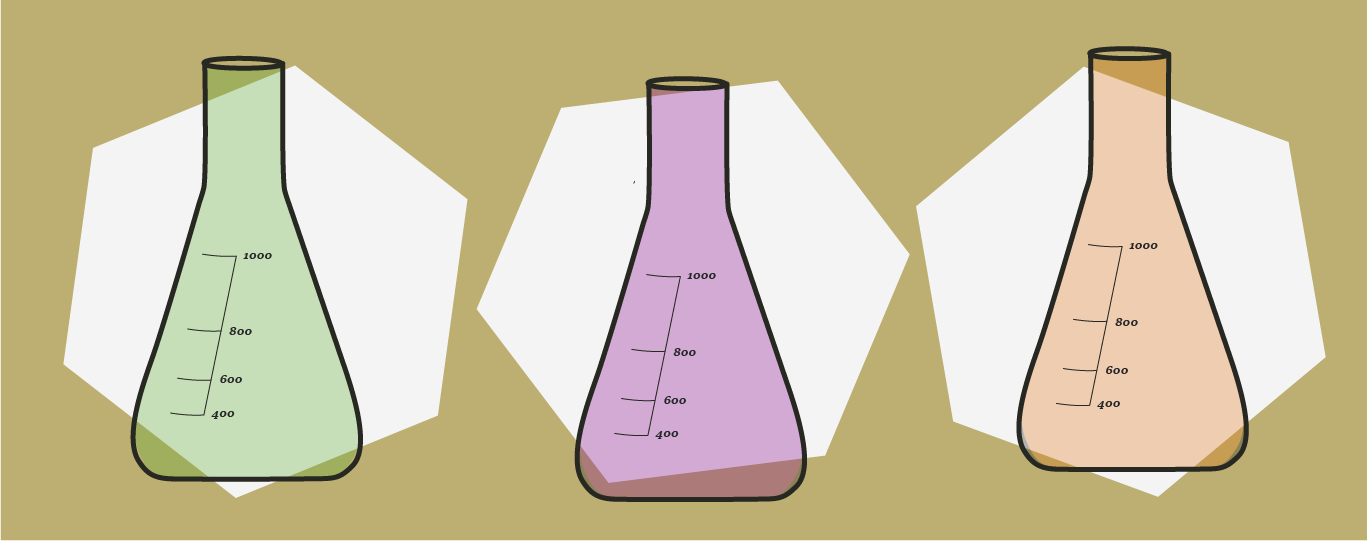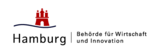REACH Hamburg
REACH Hamburg ist ein selbstorganisiertes Kompetenznetzwerk regionaler Unternehmen und Behörden.
Der Austausch zu aktuellen Themen im Bereich REACH und CLP sowie die Unterstützung bei der Umsetzung rechtlicher Neuerungen stehen im Mittelpunkt der Netzwerkaktivitäten.
Wir unterstützen und halten unsere Teilnehmer*innen auf dem neuesten Stand zur europäischen Chemikalienverordnung.